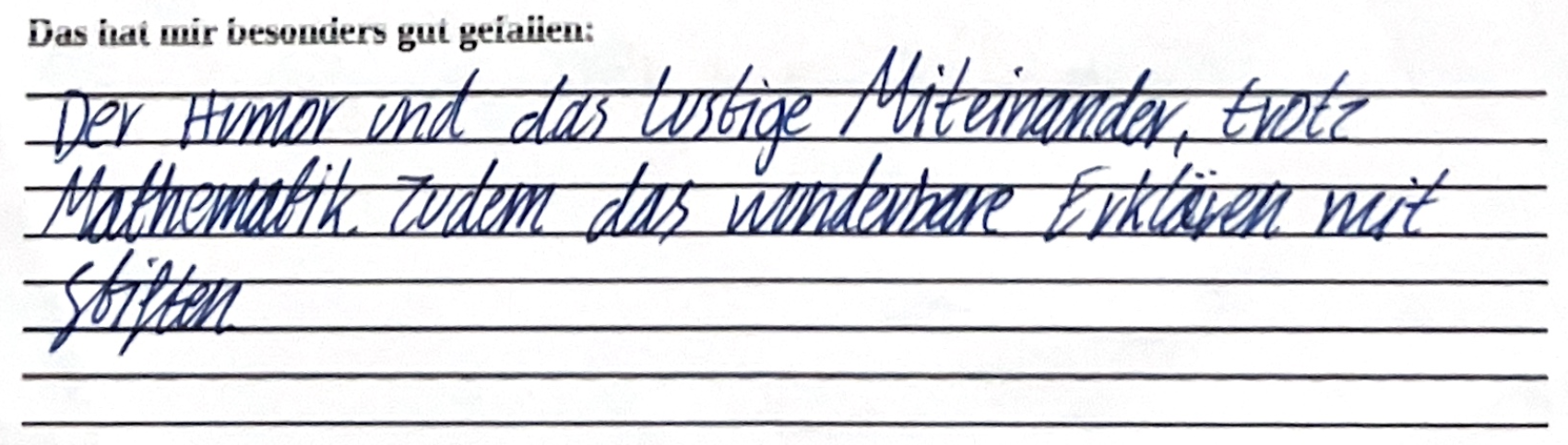Eine Liebeserklärung an den Lehrerberuf
Weil ich weitergeben möchte, was mich selbst positiv geprägt hat.
Weil ich meine Schülerinnen und Schüler die Mathematik, Psychologie und Philosophie entdecken lassen will.
Weil ich mich seit der Grundschule dazu berufen fühle, Lehrer zu sein.
Erfahrungen, die meinen Unterricht prägen

Manchmal braucht es nur die richtigen Lehrkräfte
Habe ich die Q2 mit Ø 1,2 abgeschlossen und mein Studium mit Ø 1,5 und Ø 1,0 beendet, weil ich es einfach „drauf“ habe? Die wenigsten würden vermuten, dass mein Schnitt in der 5. Klasse bei Ø 3,3 lag – auf der Schulform Gymnasium, für die mir übrigens keine Empfehlung ausgesprochen worden war.
Als Erstakademiker hatte ich keine optimalen Startbedingungen. Gelegentlich war ich sicher auch anstrengend. Umso dankbarer bin ich drei Lehrkräften aus meiner Schulzeit, die sich Zeit genommen, an mich geglaubt und mich nicht aufgegeben haben – damit ich der werden konnte, der ich heute bin. Und auch später begegneten mir Menschen, die mich auf meinem Weg gestärkt haben: der Betreuer meiner Masterarbeit und ein Referent der Studienstiftung, die mir mit ihrer Unterstützung viel bedeutet haben.
Heute strebe ich danach, für meine Schülerinnen und Schüler das zu sein, was diese Menschen damals für mich waren. Ob Rabauke oder Ausnahmetalent – „beim Zabo“ bekommt jeder die Unterstützung, die er braucht.
Der Schlüssel zum Erfolg? Teamgeist!
Während meines Studiums habe ich die Bedeutung von Teamgeist in ganz unterschiedlichen Kontexten erlebt – sei es als ehrenamtliches Mitglied in zwei Fachschaftsräten („wurde im Haushaltsplan wirklich alles berücksichtigt?“) oder als Übungsleitung zweier Übungsgruppen („stockt es nur bei uns beim Satz von Picard-Lindelöf?“). Als Studienleitung lernte ich, wie essenziell kluges Delegieren ist: Ich brauche noch Probanden mit einem bestimmten Merkmal? Dann frage ich Person A. Bei der Studiendurchführung fehlt geeignetes Material? Person B hat die Lösung. Und wenn SPSS Probleme macht, zähle ich auf das Know-how von Person C. Besonders im Vorbereitungsdienst – mit noch knapperer Zeit und zusätzlichen familiären Verpflichtungen als Vater – wurde mir klar: Kollegiale Zusammenarbeit ist kein „Nice-to-have“, sondern das Fundament eines gelingenden Lehreralltags.
Am eindrucksvollsten jedoch haben mir die Sommerakademien der Studienstiftung des deutschen Volkes die Kraft echter Zusammenarbeit vor Augen geführt. Die Erfahrung, gemeinsam mit Menschen aus unterschiedlichen Fachrichtungen und mit vielfältigen Expertisen an interdisziplinären Projekten zu arbeiten, hat meine Sicht auf Teamgeist nachhaltig geprägt.
„Beim Zabo“ lernen Schülerinnen und Schüler, dass man als Einzelkämpfer nicht weit kommt. Es gibt immer jemanden, der in einem bestimmten Bereich mehr Erfahrung oder Wissen mitbringt. Wer im Berufsleben bestehen möchte, muss nicht nur im Team arbeiten können, sondern auch bereit sein, Verantwortung zu teilen.
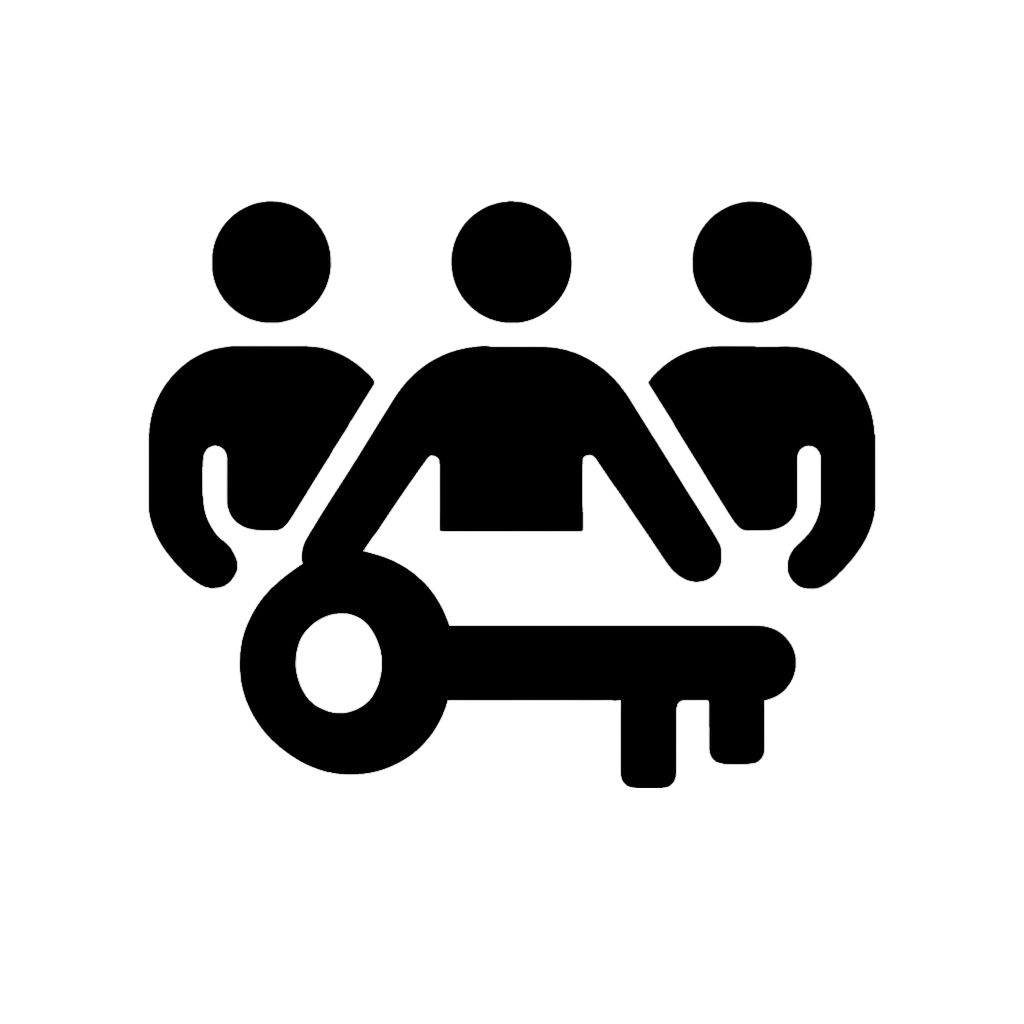
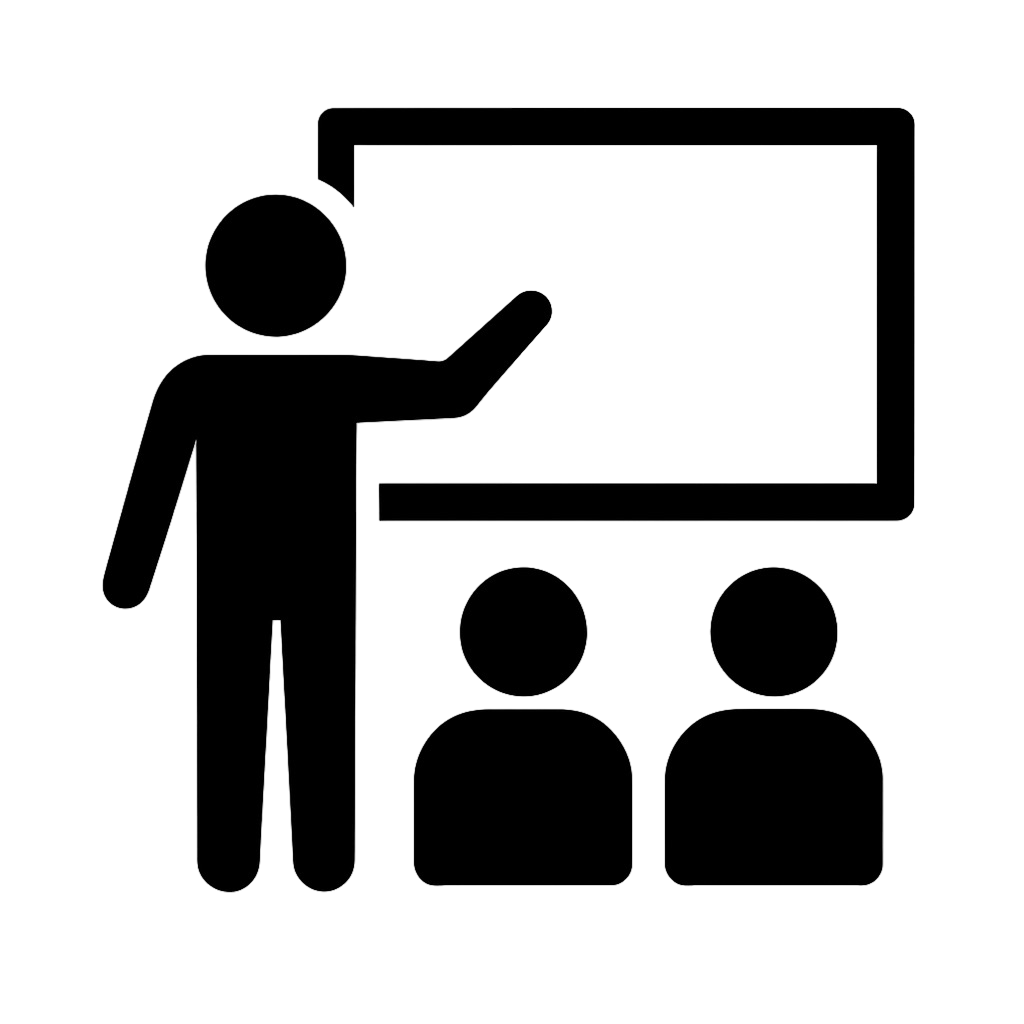
Theorie ohne Praxis ist leer
Schon in der Grundschule fühlte ich mich zum Lehrerberuf hingezogen — und nutzte neben dem Geben von Nachhilfeunterricht früh jede Gelegenheit, den schulischen Alltag auch aus Lehrerperspektive kennenzulernen:
| Zeitpunkt | Name | Dauer | Schulform | Stadt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als EF-Schüler | Betriebspraktikum | zwei Wochen | Gymnasium | Essen |
| 2. | nach Schulabschluss | Eignungspraktikum | vier Wochen | Gymnasium | Essen |
| 3. | zum Studienbeginn | Orientierungspraktikum | vier Wochen | Gymnasium | Dortmund |
| 4. | zum Studienende | Praxissemester | ein halbes Jahr | Gesamtschule | Bochum |
| 5. | nach Studienende | Vertretungslehrertätigkeit | ein halbes Jahr | Gesamtschule | Dortmund |
| 6. | derzeit | Vorbereitungsdienst | anderthalb Jahre | Gymnasium | Herne |
So durfte ich über die Jahre hinweg Lernende verschiedener Generationen an Gymnasien, Gesamtschulen und Universitäten begleiten – und erhielt dabei ebenso vielfältiges wie wertvolles Feedback.
Wissen, wovon man spricht
Wer sein Wissen nur aus Büchern und Vorlesungen bezieht, kann es selten so lebendig und authentisch vermitteln wie jemand, der auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen kann.
Im Psychologieunterricht werden Experimente analysiert und psychische Erkrankungen thematisiert. Ich beließ es nicht dabei, diese Themen nur theoretisch zu studieren: Als Studienleitung habe ich selbst die Verantwortung für Planung, Durchführung und Auswertung eines Experiments übernommen – und in einem Praktikum an einer Psychiatrie die Möglichkeit genutzt, mit Betroffenen in direkten Austausch zu kommen und ihre Sichtweisen kennenzulernen.
In der allgemeinen Lehrkräfteausbildung wird deutlich, wie unterschiedlich die Erfahrungswelten sind, in denen Schülerinnen und Schüler aufwachsen. Als Erstakademiker und Stipendiat kenne ich selbst zwei sehr verschiedene soziale Kontexte – eine Erfahrung, die mir hilft, unterschiedliche Perspektiven besser zu verstehen und mich auf Augenhöhe in verschiedene Schülerbiografien einzufühlen.
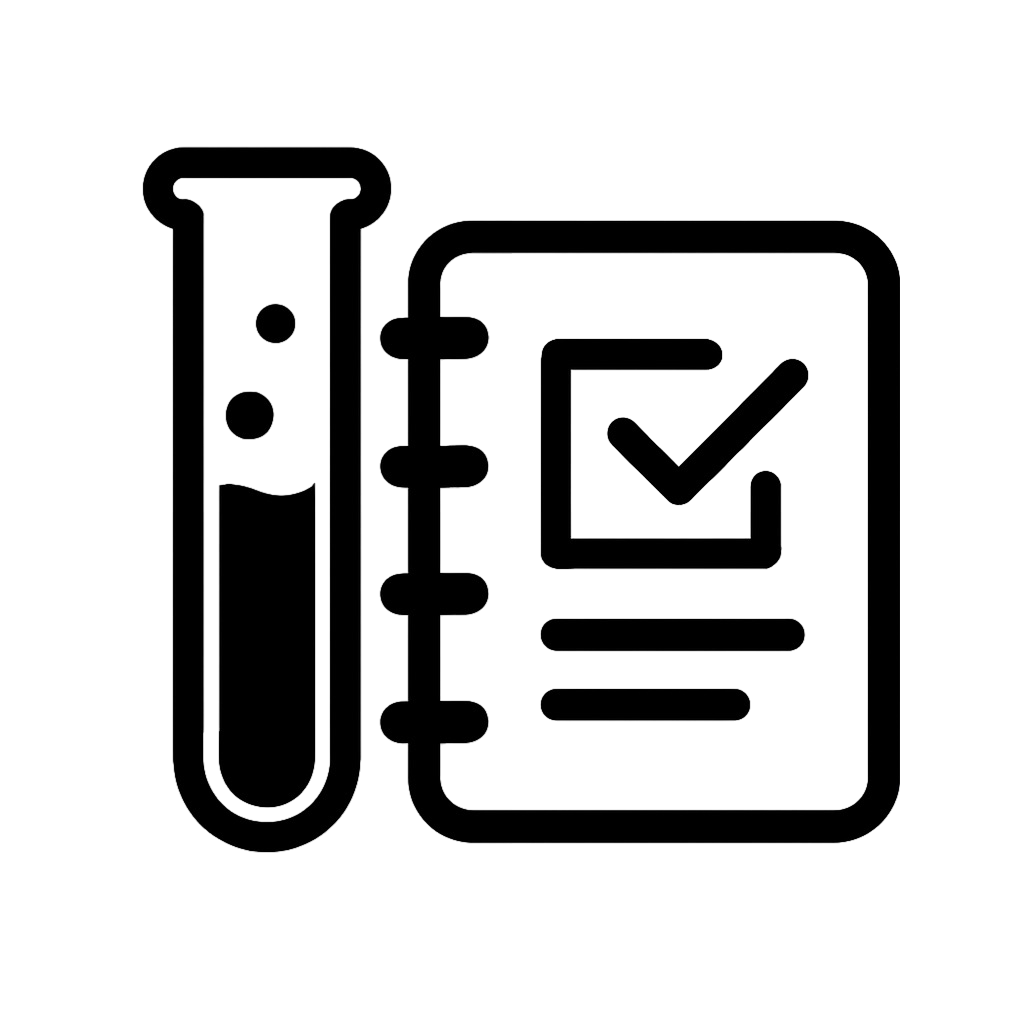

Ein Studium ist keine „Schule 2.0“
Im Studium wird deutlich mehr Selbstständigkeit erwartet als in der Schule. Als Übungsleitung fiel mir regelmäßig auf, dass viele Erstsemester überfordert waren – und das nicht wegen fachlicher Wissenslücken, sondern weil ihnen Lerntechniken und Orientierungswissen fehlte.
Deshalb gehört zu meinem wissenschaftspropädeutischen Oberstufenunterricht nicht nur fachliche Vorbereitung, sondern auch die Vermittlung metakognitiver Lernstrategien („wie lerne ich strukturiert?“), impliziter Regeln („wie schreibe ich eine E-Mail an einen Professor?“) und alltagspraktischer Ratschläge („wie beantrage ich BAföG?“, „wie bewerbe ich mich initiativ für ein Stipendium?“).
So starten meine Schülerinnen und Schüler mit realistischen Erwartungen an ein Studium – und mit der Offenheit, auch andere Bildungswege als sinnvolle Alternative zum Studium zu sehen. Wer früh merkt, dass ein Studium nicht der richtige Weg ist, hat die Chance, in einer Ausbildung Erfüllung zu finden, statt sich durch eine frustrierende Studiensituation zu quälen – nur weil oft angenommen wird, dass ein Abitur zwangsläufig ins Studium führen muss.
Wie der Spagat zwischen Lernen und Bewertung gelingt
Leistungsbewertung gehört zu den herausforderndsten Aufgaben im Lehrerberuf – sie kann Türen öffnen, aber auch verschließen. Wer etwa ein Medizinstudium anstrebt, weiß: Schon ein Schnitt von 1,3 kann zum Hindernis werden. Notendruck erzeugt Stress und Angst – beides steht nachhaltigem Lernen im Weg.
Wie viel Verantwortung solche Entscheidungen mit sich bringen, habe ich eindrücklich erlebt, als ich ehrenamtlich in einer Auswahlkommission der Studienstiftung des deutschen Volkes mitwirkte. Dass ich mein eigenes Studium durch dieses Stipendium finanzieren konnte, ließ mich die Tragweite jeder Einzelfallentscheidung umso deutlicher spüren.
Mein Gegenmittel gegen Notendruck heißt Transparenz. Ich mache für meine Schülerinnen und Schüler jederzeit nachvollziehbar, wo sie stehen, was von ihnen erwartet wird – und wie sie sich gezielt verbessern können. Das Erreichen einer angestrebten Note begleite ich dabei stets mit individueller Förderung.
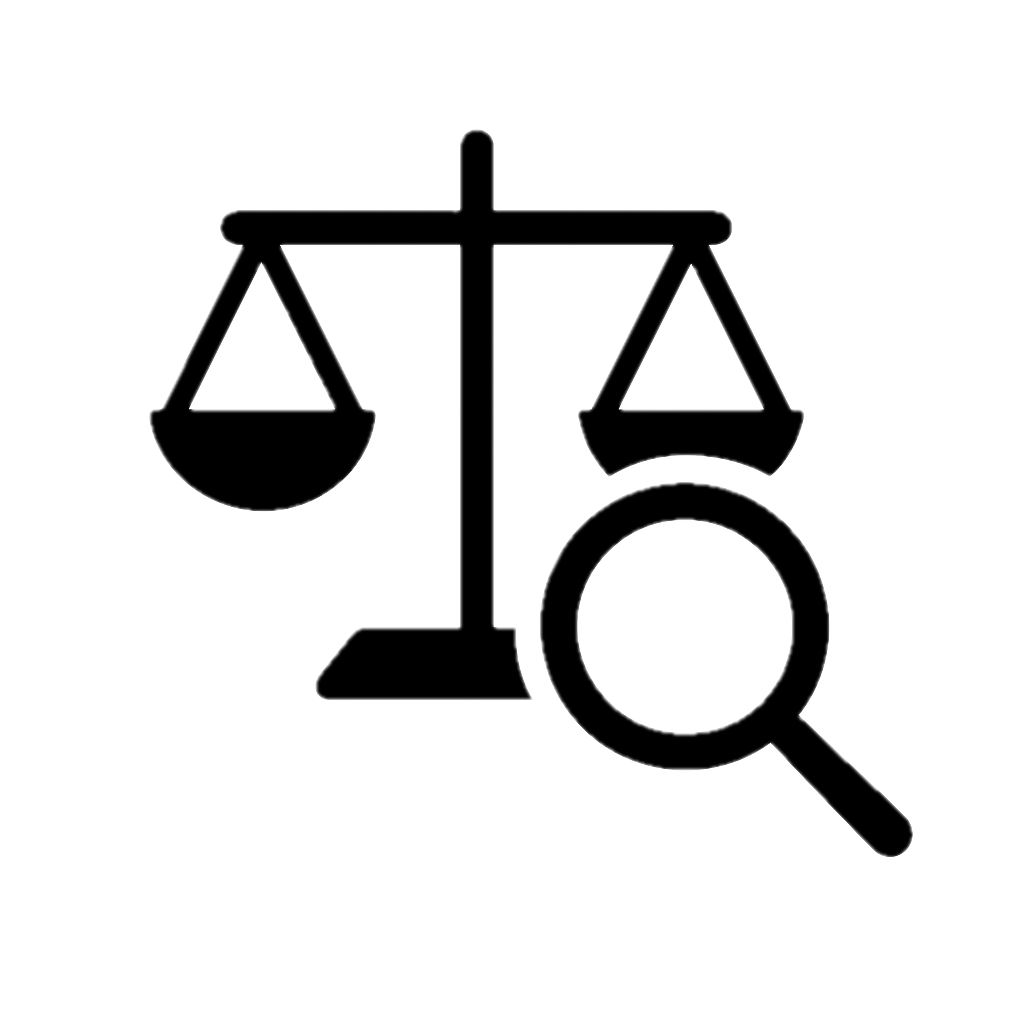
Echo aus der Praxis